Wissenschaftliche Literatur Kritik
Eine Auswahl unserer Fachbücher
Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.
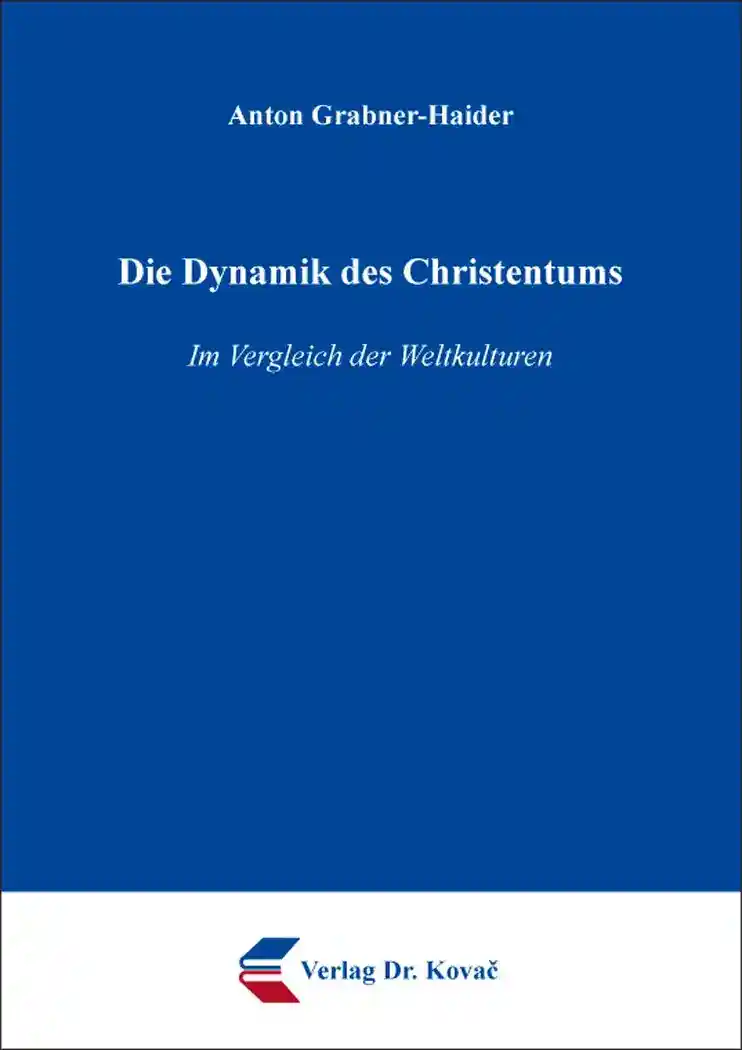 Zum Shop
Zum ShopAnton Grabner-Haider
Die Dynamik des Christentums
Im Vergleich der Weltkulturen
Schriften zur Religionswissenschaft
Das Christentum ist die größte Weltreligion, rund 2,4 Milliarden Menschen sind von ihr geprägt.
Kulturgeschichtlich gesehen entstand es als kreative Verbindung von jüdisch-semitischen und von griechischen Weltdeutungen. Damit sind auch Lehren der griechischen Philosophie, der Stoiker und der Kyniker aufgenommen worden.
Diese Religion hat sich dynamisch weiterentwickelt, als sie zur römischen Reichsreligion wurde. Durch die Prozesse der rationalen…
Allgemeine MenschenrechteChristianity of LaicsChurch ReligionCritical Philosophy of ReligionCultural MemoryCultural ReligionCulture of PeaceDeconstructionDekonstruktionDialog mit Atheisten und AgnostikernDialogue with Atheists and NaturalistsHuman RightsKirchenchristentumKritische ReligionsphilosophieKulturchristentumKultur des FriedensKulturelles GedächtnisLaienchristentumNatural Sciences Rational Enlightment Critics of ReligionNaturwissenschaftliches WeltbildRationale AufklärungReligionskritikTransformationWeltkulturen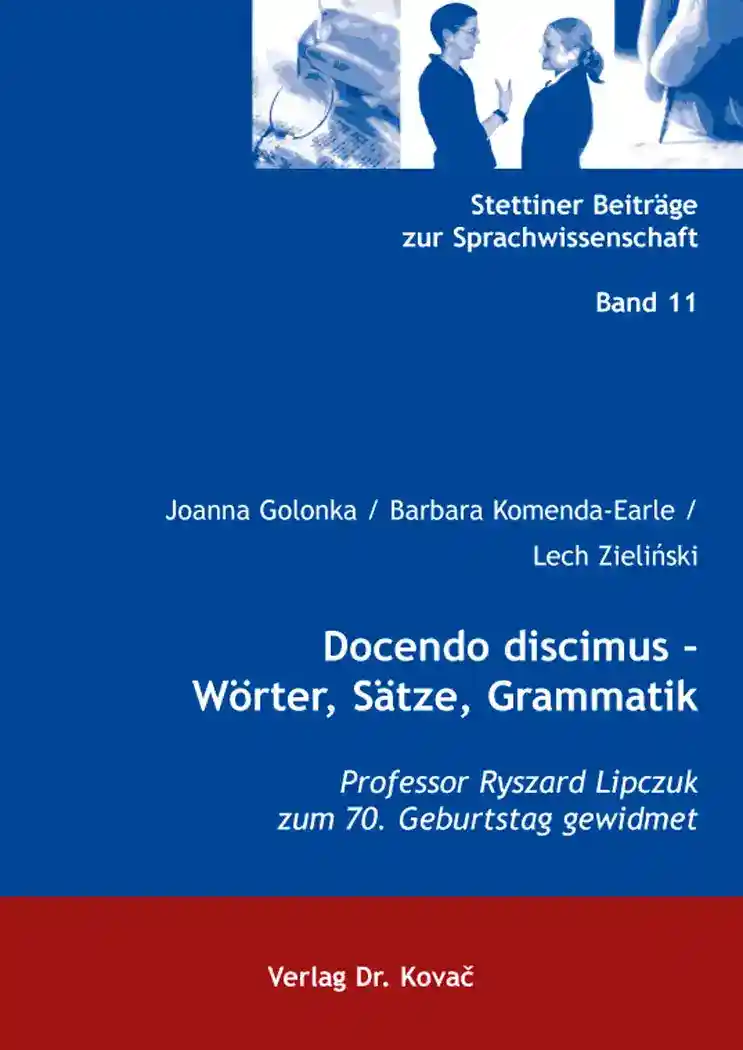 Zum Shop
Zum ShopJoanna Golonka / Barbara Komenda-Earle / Lech Zieliński
Docendo discimus – Wörter, Sätze, Grammatik
Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet
Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft
Der Band versammelt Beiträge aus drei Themenbereichen: Wörterbuchforschung, Phraseologie und Grammatik. Die drei unabhängigen Teilen wurden von drei Autoren verfasst. Den Inhalt des Beitrags von Joanna Golonka bilden syntaktisch-pragmatische Valenzanalysen. Barbara Komenda-Earle widmet ihren Beitrag drei sprichwörtlichen Gattungen: der Sentenz, der Maxime und dem geflügelten Wort. Lech Zieliński thematisiert in seinem Beitrag den lexikographischen…
DDRDDR WortschatzGeflügeltes WortGrammatikMaximeRyszard LipczukSätzeSentenzSprachwissenschaftSprichwörtliche GattungenSprichwortTextsorte „Wissenschaftlicher Artikel“VerbvalenzWörterbuchgeschichteWörterbuchkritik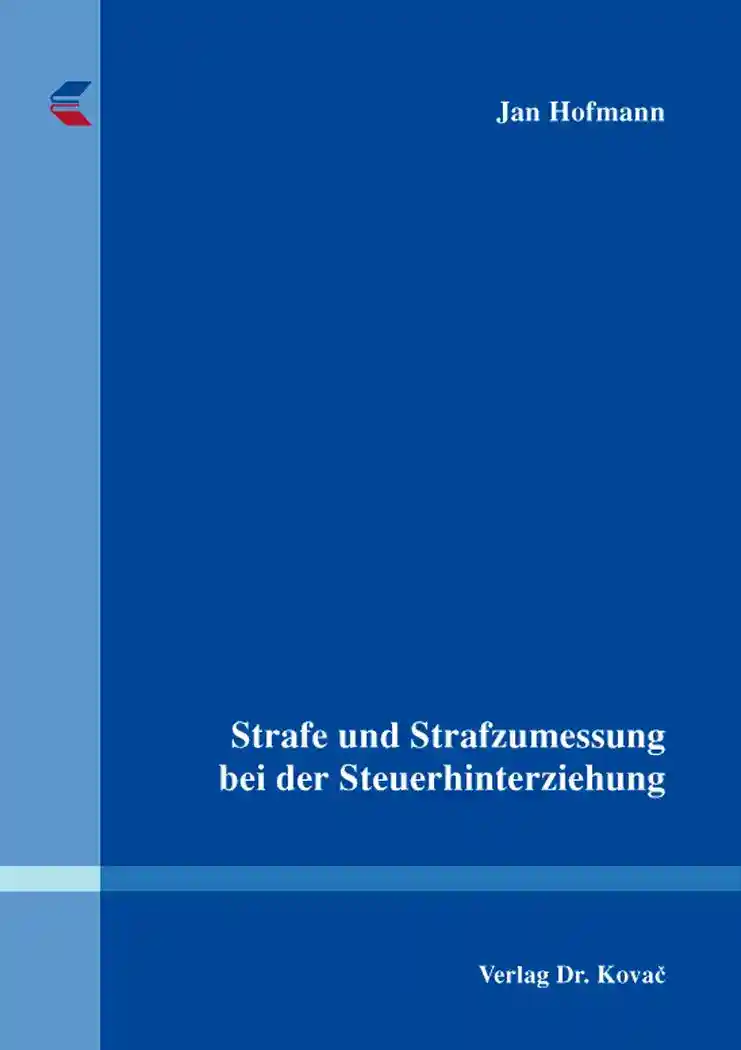
Jan Hofmann
Strafe und Strafzumessung bei der Steuerhinterziehung
Steuerrecht in Forschung und Praxis
Die im Zeitraum zwischen Juli 2014 und Dezember 2015 entstandene Würzburger Studie widmet sich in ihrem ersten Hauptteil straf- und strafzwecktheoretischen Grundlagen sowie in ihrem zweiten Hauptteil der Strafzumessung jeweils speziell bei der Steuerhinterziehung. Nachdem zu Beginn die Legitimation der Strafverhängung gegenüber dem Steuerhinterzieher erörtert wird, untersucht der Verfasser im Folgenden den aktuellen strafzwecktheoretischen Zustand des Straftatbestands der…
Geldauflage nach § 153a StPOKriminalstrafeLebensleistung bei StrafzumessungLegitimation von StrafeMissglückte SelbstanzeigeRechtsprechung des BGH zur Strafzumessung bei SteuerhinterziehungSteuerhinterziehungSteuerstrafrechtStrafbefreiende SelbstanzeigeStrafempfindlichkeitStrafe nach TabelleStrafzweck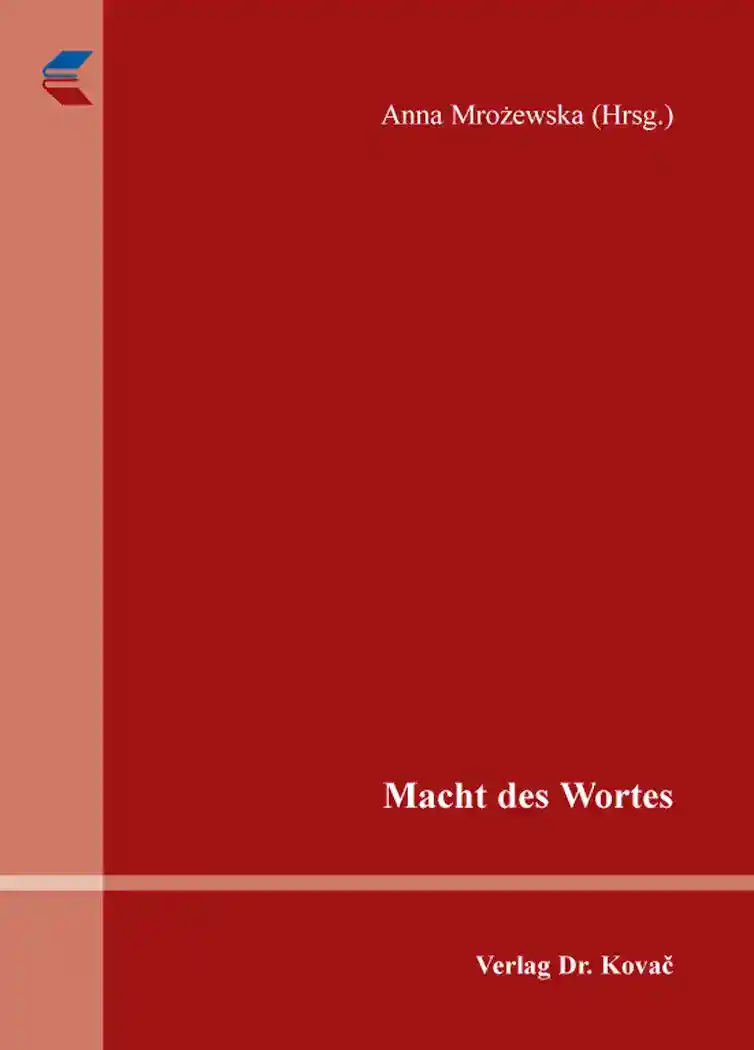
Anna Mrozewska (Hrsg.)
Macht des Wortes
„Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen.“
Lk 21,33
Mag dieses Bibelzitat die Endzeit der Menschheit prophezeien, seine Botschaft erinnert uns zugleich an die Macht des Wortes; das heißt, an die Frage, welche Inhalte es mit sich bringt und verbreitet, sowie die Frage nach den Konsequenzen, die man sich von ihm erhofft.
Verbreitet das Wort die Gebote der Wahrhaftigkeit, der…
ÄngsteAufklärungsoptimismusAutoritätChristenDDRDrittes ReichEnglische LyrikErster WeltkriegGullivers ReisenHassHumanitätInnere EmigrationKulturpolitikLegitimationLiteraturwissenschaftManipulationMündigkeitNationalsozialismusPolitische BevormundungSprachlenkungSprachlenkung in der DDRSprachmanipulationSprachwissenschaftUnmündigkeitUrteilskraftVerunsicherungWahrhaftigkeit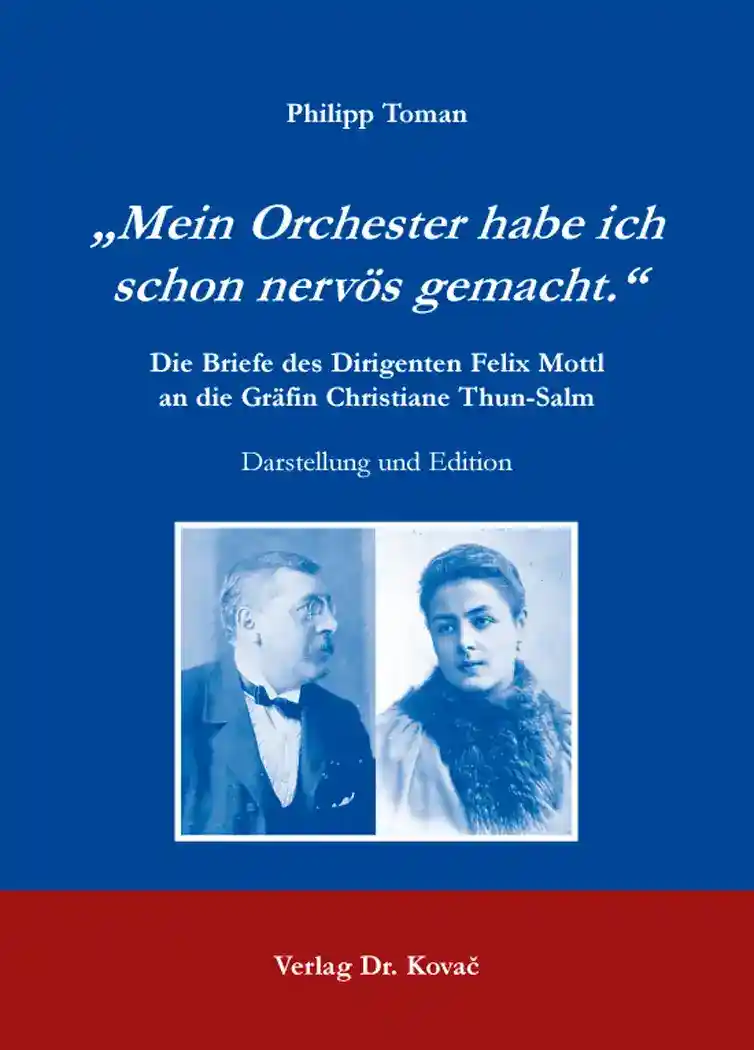
Philipp Toman
„Mein Orchester habe ich schon nervös gemacht.“
Die Briefe des Dirigenten Felix Mottl an die Gräfin Christiane Thun-Salm
Darstellung und Edition
Die Sammlung von Handschriften und alten Drucken der Österreichischen Nationalbibliothek beherbergt ein musikgeschichtlich und kulturhistorisch wertvolles, aus über 200 Schriftstücken bestehendes, Konvolut von Briefen des Dirigenten Felix Mottl an die Gräfin Christiane Thun-Salm.
Felix Mottl (1856–1911) gilt als einer der wichtigsten Dirigenten seiner Zeit und zeichnete sich als leidenschaftlicher Verfechter der Werke Richard Wagners aus. Im Laufe seiner…
Bayreuther FestspieleCosima WagnerDirigentFelix MottlGräfin Christiane Thun-SalmGustav MahlerKarlsruheKulturgeschichteMetropolitan OperaMünchenRichard WagnerSiegfried WagnerWienWiener Philharmoniker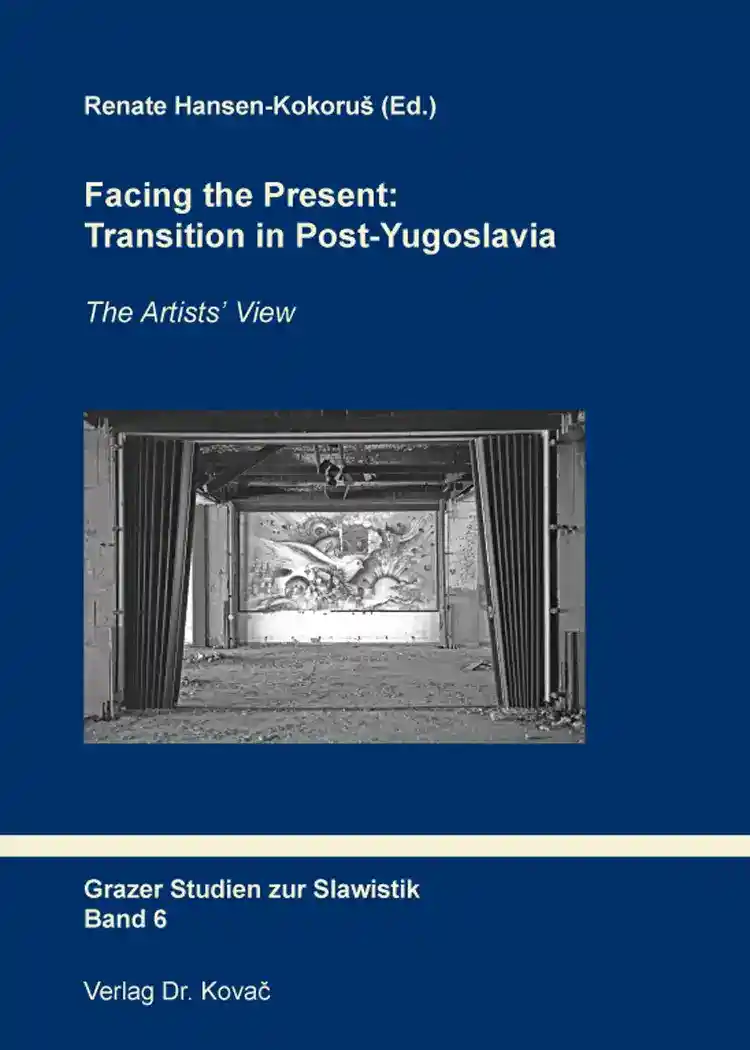 Zum Shop
Zum ShopRenate Hansen-Kokoruš (Ed.)
Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia
The Artists‘ View
The book presents contributions of the international conference „Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia – The Artists’ View”, which took place in Graz, March 21–22 2014. It combines artists from the region who work in the fields of literature, film and theater with academics who research Balkan topics in the fields of literature, film, politics and anthropology. It brings into focus how arts and artists reflect transition and how the arts are reflected in…
FilmwissenschaftGeschlechterrollenGrenzenIdeologiekritikKriegsverarbeitungKulturwissenschaftKunstkritikNeue ThemenPOSA-JugoslawienPostjugoslawischer FilmSüdslawische LiteraturenSüdslawisches DramaSüdslawistikTransition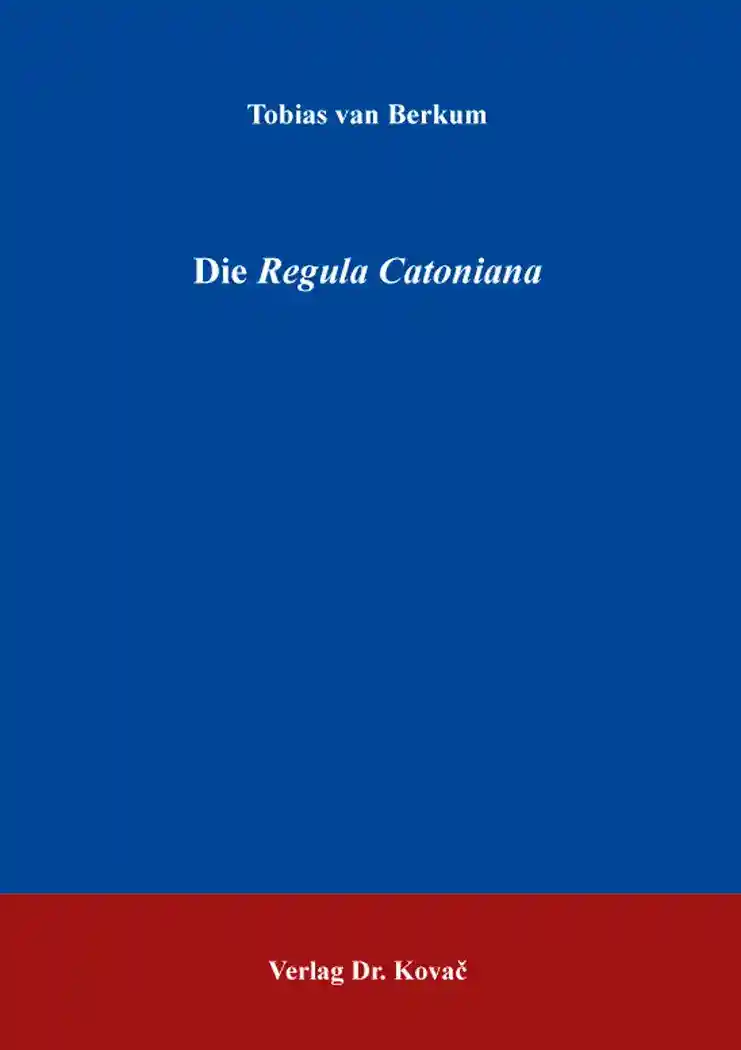 Zum Shop
Zum ShopTobias van Berkum
Die Regula Catoniana
Die Regula Catoniana wird von dem römischen Juristen Celsus im 35. Buch seiner Digesten (D. 34,7,1 pr.) wie folgt definiert: „Ein Vermächtnis, das unwirksam gewesen wäre, wenn der Erblasser im Zeitpunkt der Testamentserrichtung gestorben wäre, ist unwirksam, wann immer der Erblasser verstirbt.“ Die Regel betrifft damit eine zeitlose Fragestellung, nämlich ob ein Vermächtnis noch wirksam werden kann, wenn es allein an den Umständen bei Testamentserrichtung gemessen…
CatoErbrechtPrivatrechtRechtsgeschichteRechtsregelRechtswissenschaftRegula CatonianaRömisches RechtVermächtnis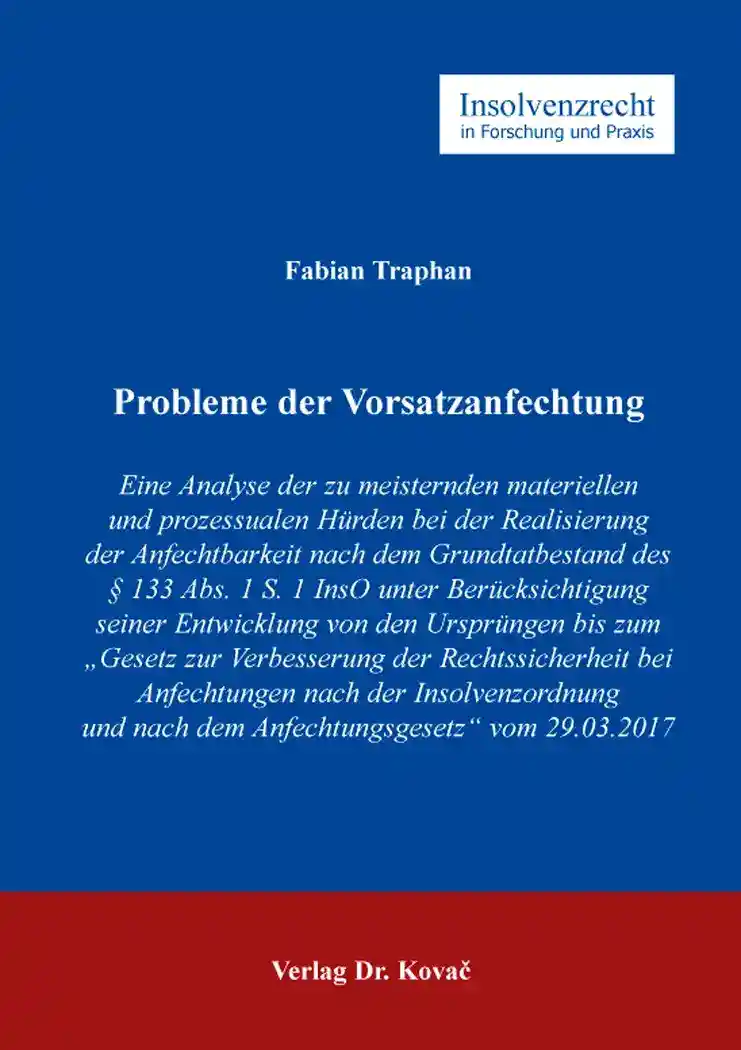 Zum Shop
Zum ShopFabian Traphan
Probleme der Vorsatzanfechtung
Eine Analyse der zu meisternden materiellen und prozessualen Hürden bei der Realisierung der Anfechtbarkeit nach dem Grundtatbestand des § 133 Abs. 1 S. 1 InsO unter Berücksichtigung seiner Entwicklung von den Ursprüngen bis zum „Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nachd er Insolvenzverordnuung und nach dem Anfechtungsgesetz" vom 29.03.2017
Insolvenzrecht in Forschung und Praxis
Kaum ein Tatbestand des Insolvenz(anfechtungs)rechts wurde in der jüngeren Vergangenheit so intensiv diskutiert wie der seit dem 01.01.1999 unveränderte Grundtatbestand der sog. Vorsatzanfechtung gemäß § 133 Abs. 1 S. 1 InsO.
Die in der Diskussion zu vernehmenden Stimmen waren in ihrer Bewertung ebenso deutlich wie konträr: Während die Vorsatzanfechtung auf der einen Seite teilweise hochtrabend als „effektives Instrument der Massegenerierung“ oder sogar als…
BargeschäftBeweisanzeichenGläubigerGläubigerbenachteiligungGläubigerbenachteiligungsvorsatzInsolvenzanfechtungInsolvenzanfechtungsrechtInsolvenzrechtInsolvenzverwalterKenntnisSanierungSanierungsversuchVorsatzanfechtungZahlungsunfähigkeit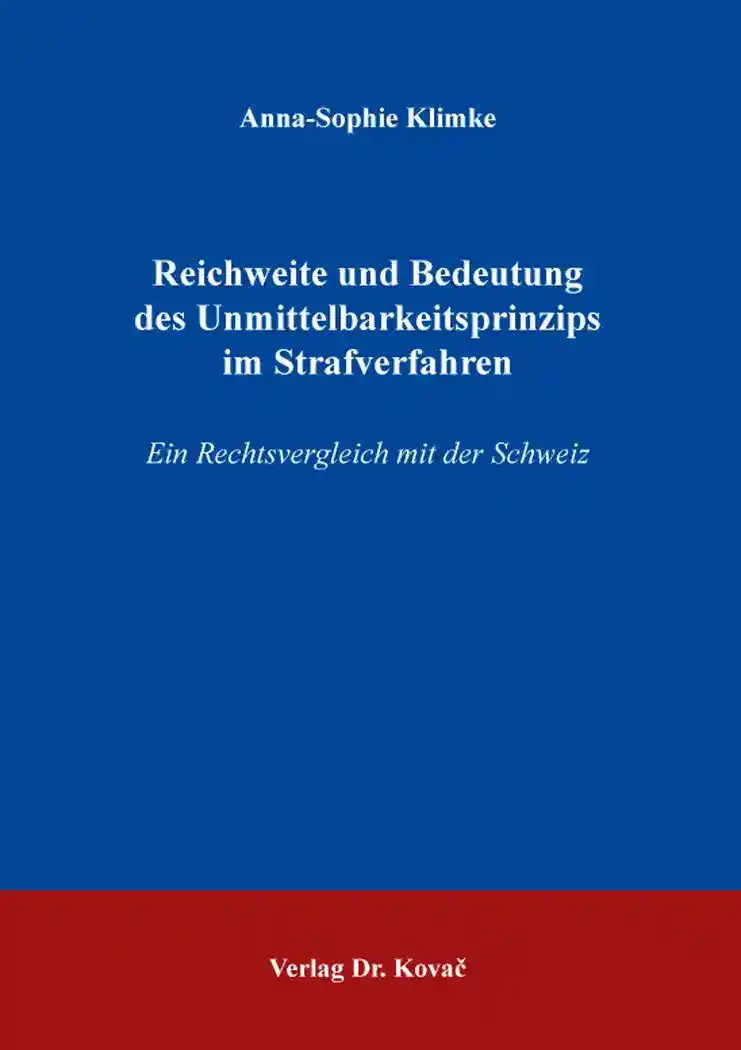 Zum Shop
Zum ShopAnna-Sophie Klimke
Reichweite und Bedeutung des Unmittelbarkeitsprinzips im Strafverfahren
Ein Rechtsvergleich mit der Schweiz
Schriften zum Strafprozessrecht
Das Unmittelbarkeitsprinzip bildet mit den übrigen Prozessmaximen seit den Reformbestrebungen des 19. Jahrhunderts die Säulen des Strafverfahrens. Ziel des Unmittelbarkeitsprinzips ist die Erforschung der materiellen Wahrheit, die Sicherung der Rechte der beschuldigten Person sowie die klare Trennung von Ermittlungsverfahren und Hauptverfahren.
Nach dem Prinzip soll sich das Gericht in seiner Urteilsfindung grundsätzlich auf originäre Beweise und nicht auf…
ErmittlungsverfahrenHauptverfahrenProzessmaximenRechtsvergleichSchweizStrafprozessrechtStrafrechtStrafverfahrenUnmittelbarkeitsprinzipUrteilsfindungVerfahrensgrundsätze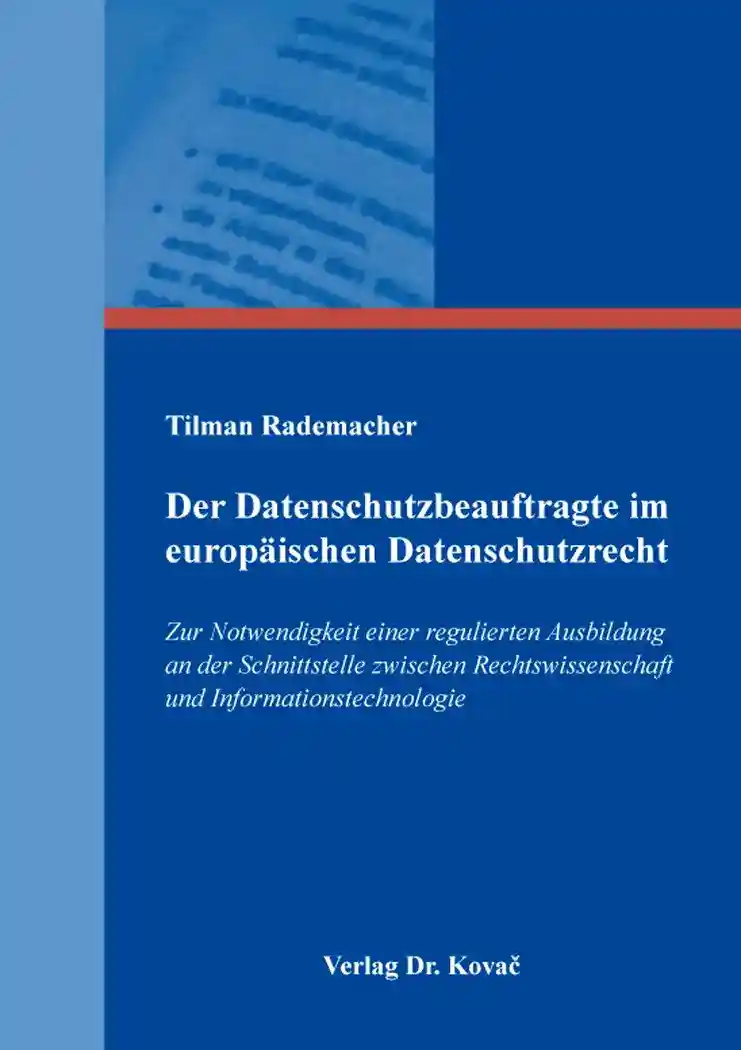 Zum Shop
Zum ShopTilman Rademacher
Der Datenschutzbeauftragte im europäischen Datenschutzrecht
Zur Notwendigkeit einer regulierten Ausbildung an der Schnittstelle zwischen Rechtswissenschaft und Informationstechnologie
Beiträge zu Datenschutz und Informationsfreiheit
„Der Datenschutzbeauftragte im europäischen Datenschutzrecht“ ordnet die Bedeutung des Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 bis 39 DSGVO ein. Die hohen gesetzgeberischen Anforderungen an das Können der Berufsträger wird der deutlich dahinter zurückbleibenden Bedeutung der Datenschutzbeauftragten in der Praxis gegenübergestellt – dort dominieren in kurzen Lehrgängen geschulte Personen ohne tieferes Fachwissen.
Rademacher plädiert für eine Professionalisierung des…
Anforderungstrias Art. 37 V DSGVOBerufsstand des DatenschutzbeauftragtenDatenschutzbeauftragterDatenschutzrechtEuropean Patent AttorneyInformationstechnologieITPatentanwalt