Wissenschaftliche Literatur 17. Jahrhundert
Eine Auswahl unserer Fachbücher
Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.
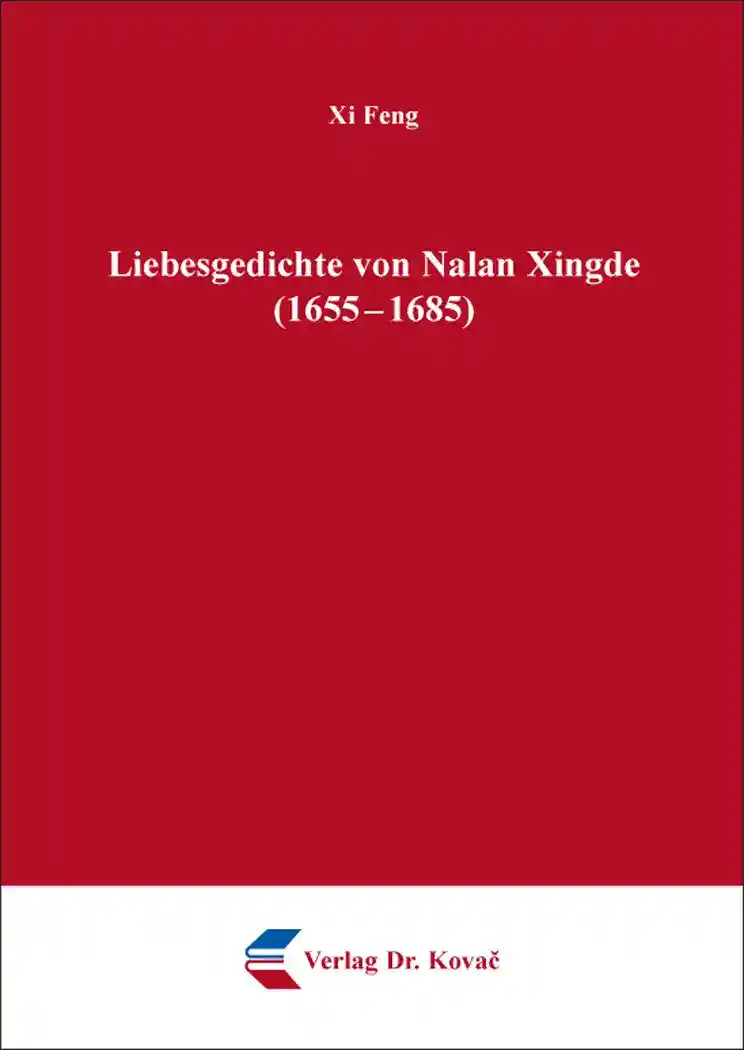 Zum Shop
Zum ShopXi Feng
Liebesgedichte von Nalan Xingde (1655 – 1685)
Schriften zur Vergleichenden Literaturwissenschaft
Nalan Xingde, dessen Werke gerade wieder eine Renaissance erleben, lebte im 17. Jahrhundert und war einer der bedeutendsten ci-Dichter Chinas. Als adliger Sohn eines mächtigen chinesischen Reichsministers und Mitglied der Palastwache führte er ein finanziell sorgenfreies Leben. Jedoch litt er sehr unter dem frühen Verlust seiner geliebten Ehefrau, der er viele rührende Gedenkgedichte widmete.
Das Buch stellt das Leben und speziell die Liebesgedichte des Dichters…
Chinesische LyrikCi-GedichteElegieGedenkgedichteJohann Wolfgang von GoetheLiebesgedichteMelancholieNalan RongruoNalan XingdeSinologieThomas HardyTrauer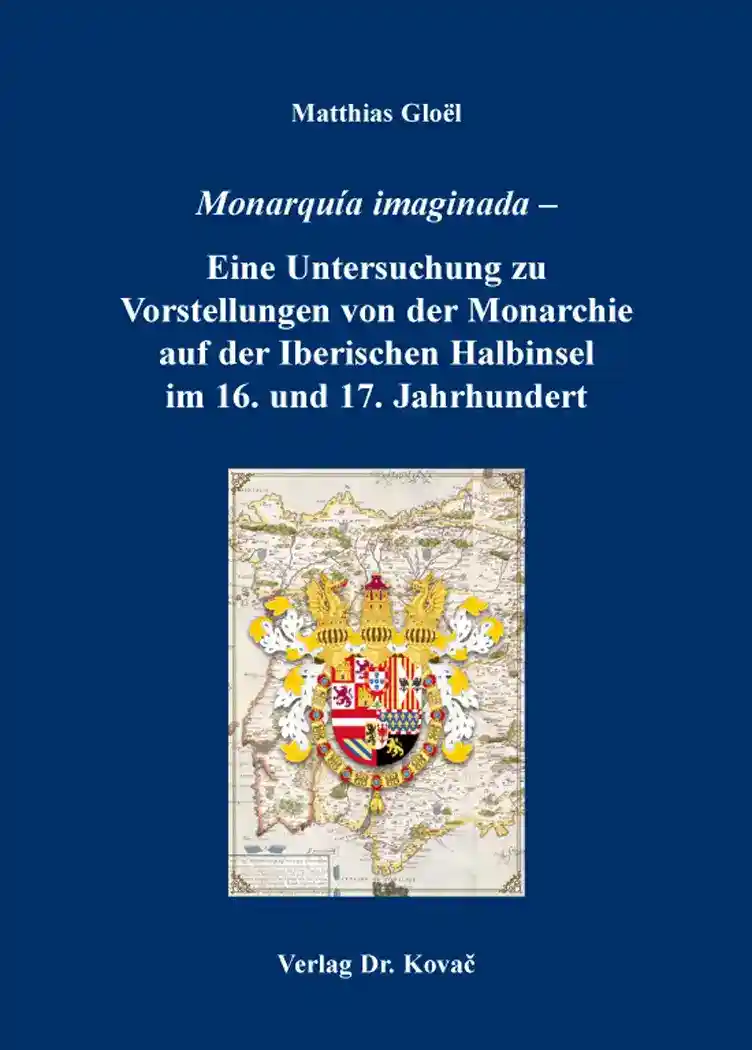 Zum Shop
Zum ShopMatthias Gloël
Monarquía imaginada – Eine Untersuchung zu Vorstellungen von der Monarchie auf der Iberischen Halbinsel im 16. und 17. Jahrhundert
Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit
Das Buch ist im Bereich der Vorstellungsgeschichte zu verorten. Es geht um unterschiedliche Vorstellungen in den verschiedenen spanischen Königreichen, Portugal eingeschlossen, von der Monarchie im 16. und 17. Jahrhundert. Die angestrebte Volksabstimmung über die Unabhängigkeit in Katalonien sowie noch nicht lang zurückliegende Vorschläge, zum Beispiel des kürzliche verstorbenen Schriftstellers José Saramago, Spanien und Portugal in einem Staat zu vereinen, zeigen die…
16. Jahrhundert17. JahrhundertFrühe NeuzeitGeschichte der GeschichtsschreibungImagologieKatalonienKöniglicher AbsentismusMonarchiePortugalPortugiesische GeschichteQuestione della linguaSitz des HofesSpanienSpanische GeschichteVorstellungsgeschichte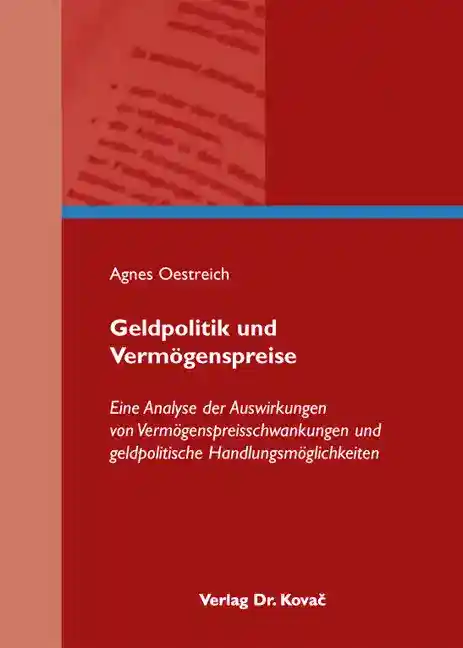 Zum Shop
Zum ShopAgnes Oestreich
Geldpolitik und Vermögenspreise
Eine Analyse der Auswirkungen von Vermögenspreisschwankungen und geldpolitische Handlungsmöglichkeiten
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
In den letzten Jahren ist vor dem Hintergrund der aktuellen Vermögenspreisentwicklungen immer wieder die Frage aufgetaucht, wie die Geldpolitik auf Vermögenspreisschwankungen reagieren sollte. Dabei sind Schwankungen von Vermögenspreisen keineswegs ein neues Phänomen. Beispiele starker Vermögenspreisschwankungen reichen zurück bis ins 17. Jahrhundert. Fraglich ist, welche Auswirkungen steigende Vermögenspreise und ein möglicherweise folgendes starkes Absinken auf die…
AktienkurseFinanzstabilitätGeldpolitikImmobilienpreiseTransmissionsprozessVermögenspreiseVolkswirtschaftslehre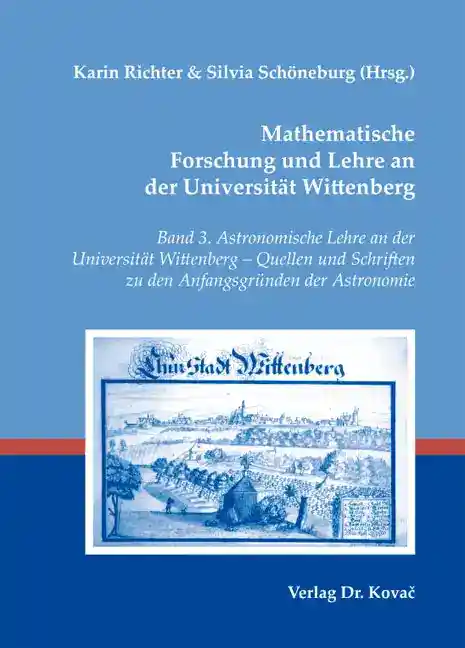 Zum Shop
Zum ShopKarin Richter & Silvia Schöneburg (Hrsg.)
Mathematische Forschung und Lehre an der Universität Wittenberg
Band 3. Astronomische Lehre an der Universität Wittenberg – Quellen und Schriften zu den Anfangsgründen der Astronomie
Mathematische Forschung und Lehre im 16. und 17. Jahrhundert
Astronomische Studien stellten in der mathematischen Lehre an der Wittenberger Universität im 17. Jahrhundert einen wesentlichen Lehrgegenstand dar. Das Buch widmet sich in seinem ersten Teil der grundlegenden Lehrbuchliteratur, die zu jener Zeit in Wittenberg Anwendung fand. Im zweiten Teil wird an den Schriften des Wittenberger Mathematikers Christoph Nothnagel beleuchtet, wie aktuelle astronomische Forschungen ihren Widerhall im Lehrbetrieb fanden. [...]
AstronomieCaspar PeucerDe sphaeraForschungJohannes de SacroboscoMathematikSebastian TheodoricusUniversität WittenbergWittenberger astronomische Schriften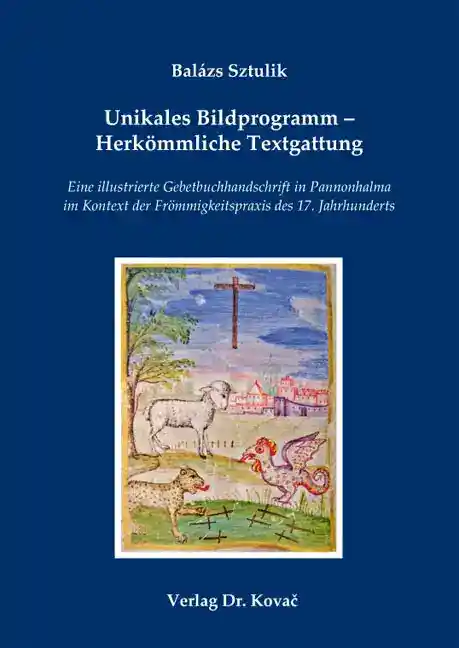 Zum Shop
Zum ShopBalázs Sztulik
Unikales Bildprogramm – Herkömmliche Textgattung
Eine illustrierte Gebetbuchhandschrift in Pannonhalma im Kontext der Frömmigkeitspraxis des 17. Jahrhunderts
Schriften zur Literaturgeschichte
Wien, Königinkloster, 1640: Drei Klarissinnen gestalten ein kleines, 50 x 70 mm großes Gebetbuch. Schwester Beatrix entwirft das ganze Konzept, verfasst die Meditationstexte und legt auch die Illustrationen fest. Schwester Anna von Thanhausen überträgt die Gebete in gotischer Schrift auf das Pergament des Büchleins, Schwester Leonora Jergerin malt die Bilder. Sie bearbeiten das Thema der Passion Christi als,horologium passionis‘. Dabei werden die frei formulierten…
17. JahrhundertBild-Text-BeziehungenDeutsche PhilologieFrömmigkeitspraxisGebetbuchhandschriftengeistliche Uhrenhorologium passionisKöniginkloster zu WienKunstgeschichtePannonhalmaPassionsfrömmigkeitPassionsstundenbuch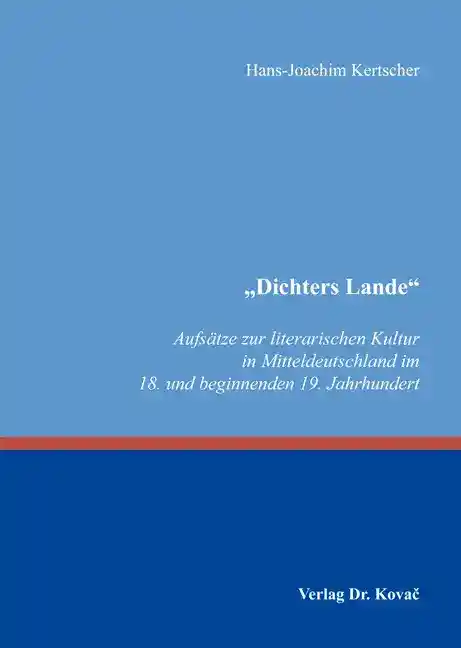 Zum Shop
Zum ShopHans-Joachim Kertscher
„Dichters Lande“
Aufsätze zur literarischen Kultur in Mitteldeutschland im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert
Schriften zur Kulturwissenschaft
Die Aufsätze, die hier vorgestellt werden, sind im Verlauf eines Forschungsprojekts entstanden, das ihr Verfasser am Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bearbeitet. Sie wurden zum größten Teil bereits an verschiedenen Orten publiziert und werden hier – teilweise, um unnötige Redundanzen zu vermeiden, gekürzt – in ihrem Wortlaut und ihrer Orthographie…
19. JahrhundertÄsthetikAlexander Gottlieb BaumgartenCarl Friedrich BahrdtCarl Hermann HemmerdeChristian KefersteinChristoph Martin WielandFriedrich SchillerFriedrich von HardenbergGeisteswissenschaftGeorg Friedrich MeierGeselligkeitGotthold Ephraim LessingJohann Jakob GebauerJohann Wolfgang von GoetheLiterarische KulturLiteraturkritikLiteraturtheorieNovalisPopularphilosophieReisenSchöngeistige LiteraturUniversitätenVerlagswesen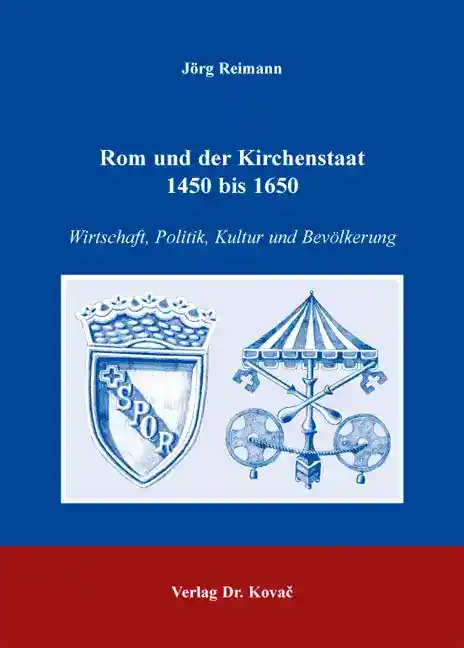 Zum Shop
Zum ShopJörg Reimann
Rom und der Kirchenstaat 1450 bis 1650
Wirtschaft, Politik, Kultur und Bevölkerung
Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit
Mit dem nun vorgelegten fünften Band zur Reihe “Italien 1450-1650" findet das Projekt nach mehr als zwölfjähriger Arbeit seinen geplanten vorläufigen Abschluss.
Als Papst Nikolaus V. (1447-1455) 1450, zu Beginn unserer Betrachtungen, aus seinem Papstpalast auf die Jubiläumsfeierlichkeiten zum Heiligen Jahr herab sah, war das auf einige Viertel begrenzt besiedelte Rom eine von Familienclans beherrschte und unsichere Stadt. Der vom Pontifex regierte Staat war…
BevölkerungGeschichteInfrastrukturKatastrophenKonklaveKulturPapsttumPolitikRegionenRomWirtschaft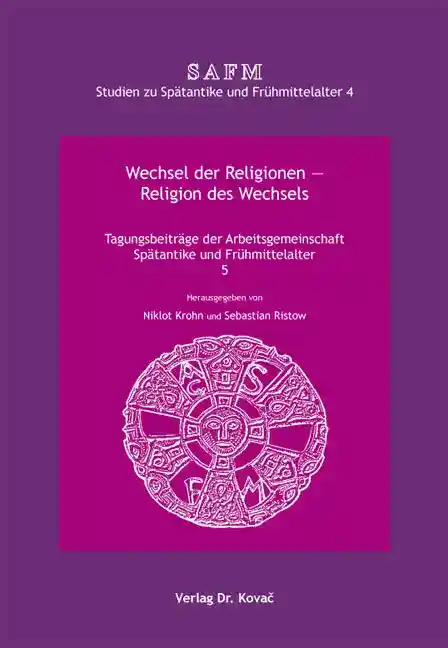 Zum Shop
Zum ShopNiklot Krohn und Sebastian Ristow (Hrsg.)
Wechsel der Religionen – Religion des Wechsels
Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und Frühmittelalter. 5. Religion im archäologischen Befund (Nürnberg, 27.–28. Mai 2010)
Studien zu Spätantike und Frühmittelalter (SAFM)
Kaum ein Themenfeld archäologischer und altertumskundlicher Forschung übt eine derart große Faszination aus wie die Entstehung und Institutionalisierung neuer Religionen und hier bevorzugt des Christentums. Dies gilt seit dem Beginn archäologischer Forschung überhaupt, also seit den Anfängen der christlichen Archäologie in Rom im 16./17. Jahrhundert.
Heute ist die Sicht auf Befunde und Funde zwar feiner und wissenschaftlich geschult, viele der…
ArchäologieArchäologische TerminologieChristentum und IslamChristianisierung EuropasChristliche BestattungChristliche InstitutionalisierungFrühmittelalterGermanenGeschichteKirchenarchäologieReligionsgeschichteRömische ProvinzenSlawenSpätantike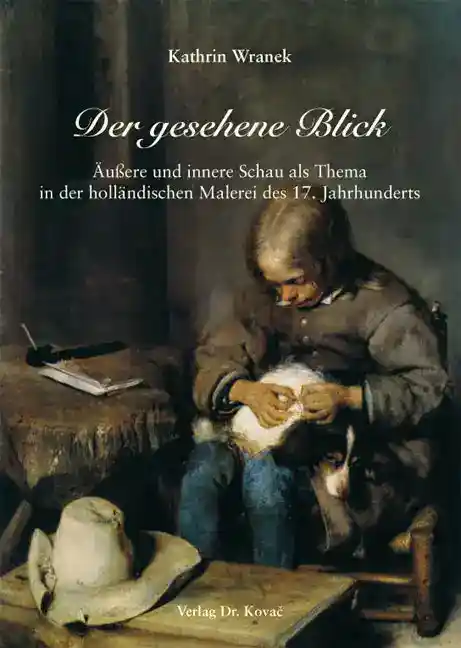 Zum Shop
Zum ShopKathrin Wranek
Der gesehene Blick
Äußere und innere Schau als Thema in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts
In Holland kam im 17. Jahrhundert verstärktes Interesse an der Funktion des Augenapparates auf. Dies spiegelt sich nicht nur in den bis heute wichtig gebliebenen, theoretischen Abhandlungen zur Entstehung des Netzhautbildes von Johannes Kepler oder René Descartes wider. Ebenso bestätigt die Entwicklung von Fernrohr und Mikroskop für die Wissenschaft jener Zeit eine intensive Auseinandersetzung mit den Augen.
Vor allem in der Malerei machte man sich das neue…
17. JahrhundertBlickGabriel MetsuHolländische MalereiJan VermeerKunstgeschichteOptikRembrandtSamuel van HoogstratenSehenWahrnehmung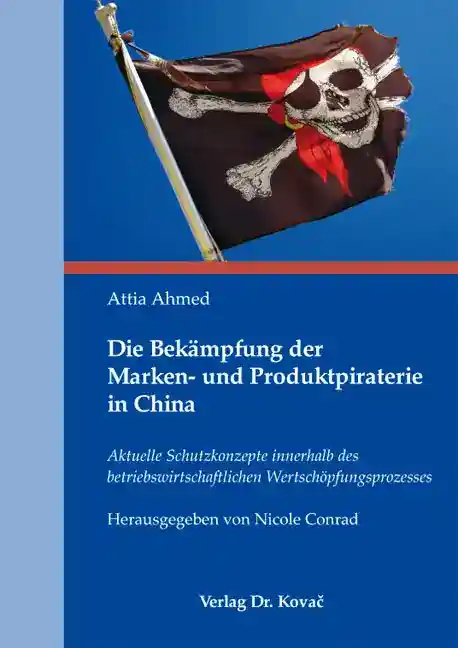 Zum Shop
Zum ShopAttia Ahmed (Autorin), Nicole Conrad (Hrsg.)
Die Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie in China
Aktuelle Schutzkonzepte innerhalb des betriebswirtschaftlichen Wertschöpfungsprozesses
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Nach einer kürzlich durchgeführten Studie geben mehr als 75% der befragten deutschen Unternehmen an, von Fälschungen ihrer Produkte betroffen zu sein. Dabei stammt mindestens die Hälfte der Fälschungen aus der Volksrepublik China. Schon im 17. Jahrhundert hielt der Spanische Priester Dominigo Navarette fest, dass die Chinesen im Nachahmen von Produkten sehr einfallsreich und geschickt seien. Das Phänomen der Marken- und Produktpiraterie gibt es in dieser Form und in…
BetriebswirtschaftslehreChinaFälschungGeistiges EigentumInnovationMarken- und ProduktpiraterieMarkenfälschungMarkenpiraterieMarkenrechtMarkenschutzPlagiatProduktpiraterieSchutz InnovationenUnternehmen China