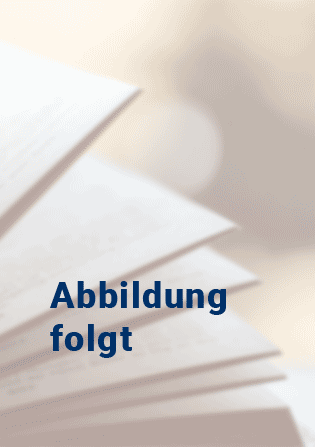
David Johannes VolkeOpferbezogene Vollzugsgestaltung im nordrhein-westfälischen Strafvollzug am Beispiel der Sozialtherapie
Eine empirische Untersuchung zu den Auswirkungen der opferbezogenen Vollzugsgestaltung auf die Resozialisierung von Inhaftierten in der Sozialtherapie
Strafrecht in Forschung und Praxis, Band 430
Hamburg 2025, 210 Seiten
ISBN 978-3-339-14390-7 (Print)
ISBN 978-3-339-14391-4 (eBook)
Zum Inhalt
Der bundesdeutsche Gesetzgeber normiert das Resozialisierungsgebot durch das am 01.01.1977 in Kraft getretene Strafvollzugsgesetz (StVollzG). Im Rahmen dieser Regelung steht der Inhaftierte im Fokus der Betrachtungen. Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) hat die opferbezogene Vollzugsgestaltung als erstes Bundesland ausdrücklich in sein Strafvollzugsgesetz aufgenommen. Am 26.01.2015 trat das Gesetz zur Regelung des Vollzuges der Freiheitsstrafe in NRW (Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen (StVollzG NRW)) in Kraft, in dessen § 7 die opferbezogene Gestaltung des Strafvollzugs geregelt wird.
Die Intention des Gesetzgebers ist es, durch die Positionierung in den Vollzugsgrundsätzen dem hohen Stellenwert des Opferschutzes und den Schutzbedürfnissen der Opfer Rechnung zu tragen. Neben § 7 StVollzG NRW enthalten die §§ 10, 25, 53, und 57 StVollzG NRW weitere detaillierte Regelungen zur opferbezogenen Vollzugsgestaltung. Dabei darf sich die opferbezogene Vollzugsgestaltung nicht gegen den Täter richten, sondern muss sich mit dem Vollzugsziel der Resozialisierung des Inhaftierten vereinbaren lassen und soll gleichzeitig die Wiedereingliederung des Inhaftierten in die Gesellschaft im Ergebnis auch fördern.
Der nordrhein-westfälische, bis dahin stark täterorientierte Strafvollzug, steht nun vor der Herausforderung der Entwicklung einer opferbezogenen Vollzugsgestaltung. Die neu geschaffenen gesetzlichen Regelungen werden nunmehr in den Justizvollzugsanstalten des Landes in die Praxis umgesetzt. Neben dem Regelvollzug wird die opferbezogene Vollzugsgestaltung u. a. auch in den sozialtherapeutischen Anstalten und Abteilungen der praktiziert.
Sozialtherapeutische Anstalten und Abteilungen sind Spezialeinrichtungen des Strafvollzugs, in denen behandlungsbedürftige Inhaftierte mit den dort konzentriert und integrativ vorhandenen therapeutischen Mitteln und sozialen Hilfen besonders effektiv auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden sollen. Sie zielen, genau wie der konventionelle Vollzug, auf die Resozialisierung (allgemeines Vollzugsziel gem. § 1 StVollzG NRW), d. h. auf die Befähigung zu einem künftigen Leben ohne Straftaten in sozialer Verantwortung, ab. Die Resozialisierung soll gem. § 13 StVollzG NRW mit geeigneten besonderen therapeutischen Mitteln und sozialen Hilfen in den sozialtherapeutischen Anstalten erreicht werden. Es handelt sich folglich um eine Behandlungsform der positiven Spezialprävention.
Die Haftpopulation der Sozialtherapie besteht weit überwiegend aus Sexualstraftätern sowie wegen schwerer Gewalttaten verurteilten Inhaftierten. Der Opferbezug spielt hier eine besondere Rolle und so werden opferbezogene Themen in der Praxis der sozialtherapeutischen Anstalt vermehrt in die Behandlungsmaßnahmen integriert. Als erste Einrichtung im nordrhein-westfälischen Justizvollzug entwickelte die Sozialtherapeutische Anstalt Gelsenkirchen (heute Bochum) im Jahr 2011 einen eigenen konzeptionellen Ansatz zur opferbezogenen Vollzugsgestaltung. Die Behandlung fördert und unterstützt sowohl das Schutzbedürfnis des Tatopfers und potenzieller Risikopersonen als auch die Verantwortungsübernahme des Inhaftierten für seine Taten sowie seine Bereitschaft, Risikosituationen und Risikomarker zu identifizieren und zu vermeiden.
Welchen Einfluss die opferbezogene Vollzugsgestaltung auf den gesetzlich normierten Resozialisierungsauftrag hat, ist bislang empirisch noch nicht erforscht. In der bestehenden Literatur wird die Forderung einiger Autoren nach einer Evaluation der Umsetzung in der Vollzugspraxis deutlich.
Auch der Justizvollzugsbeauftragte in NRW, Michael Kubink, geht auf das fehlende Wissen rund um die Umsetzung der opferbezogenen Vollzugsgestaltung in einem Statement ein: „Wir wissen bis heute nicht genau, in welchem Umfang und mit welcher Qualität die opferbezogene Vollzugsgestaltung bisher in den nordrhein-westfälischen Behandlungsvollzug eingeflossen ist. Auch die Frage, ob und inwieweit sich Opferorientierung und Resozialisierungsgedanke möglicherweise hemmen, konnte nicht beantwortet werden.“ Ebenso stellt er die Notwendigkeit klar, dass sich mit den Auswirkungen der opferbezogenen Vollzugsgestaltung auf die Resozialisierung beschäftigt werden sollte.
Daran wird in dieser Arbeit angeknüpft, indem die Umsetzung der opferbezogenen Vollzugsgestaltung anhand der Sozialtherapie im Strafvollzug von NRW untersucht wird. Dadurch soll ein erster Eindruck von der Rechtswirklichkeit der Umsetzung der opferbezogenen Vollzugsgestaltung erhalten werden. Ziel ist es herauszufinden, welche subjektiven Erfahrungen die Inhaftierten in der sozialtherapeutischen Behandlung mit der (neu geschaffenen) opferbezogenen Vollzugsgestaltung innerhalb ihres Vollzugsverlaufs machen und wie sich diese auf ihre eigene Resozialisierung auswirken können. Es gilt konkrete Faktoren zu identifizieren, die die Resozialisierung der Inhaftierten aufgrund der opferbezogenen Vollzugsgestaltung beeinflussen.
Aufgrund bislang noch fehlender Untersuchungen im Forschungsfeld der Umsetzung des opferbezogenen Strafvollzugs wird eine qualitativ-explorative Vorgehensweise in Form einer Einzelfallanalyse verfolgt. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, neue Fragestellungen aufzuwerfen und subjektive Wahrnehmungen und Erfahrungen zu erfassen, ohne dabei durch eine zu stark vorgegebene Struktur die Dynamik des Forschungsprozesses zu hemmen.
Anhand von leitfadengestützten Interviews mit Inhaftierten und Mitarbeitern der sozialtherapeutischen Anstalt in Gelsenkirchen soll herausgefunden werden, ob die (neu geschaffene) opferbezogene Vollzugsgestaltung den gesetzlichen Resozialisierungsauftrag unterstützt oder den Grundgedanken des modernen Behandlungsvollzugs beeinträchtigt.